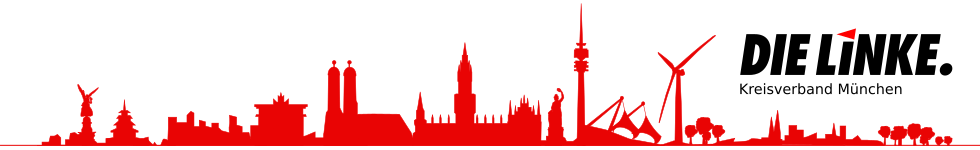Ein Monat nach dem Amoklauf am OEZ:
Nur bessere und vernetzte Prävention bringt mehr Sicherheit – statt Einschränkung unserer Grundrechte, neuer Polizeihelme und Bundeswehreinsatz im Inneren.
Der schreckliche Amoklauf vom Freitag, 22.Juli 2016 vor dem Olympiaeinkaufszentrum steckt uns Münchnern noch in den Knochen; vor allem ließ er die Wogen hochschlagen zum Thema Sicherheit: Reflexartig häufen sich die Forderungen nach mehr Panzerwagen für die Polizei, neuer Bewaffnung, besseren Helmen, strengeren Kontrollen – wen immer sie auch betreffen sollen – und vor allem dem Einsatz von Bundeswehr-Soldaten im Inneren. Zeit, um darüber nachzudenken, was uns wirklich mehr Sicherheit brächte.
Im gängigen Diskurs wird der Sicherheitsbegriff völlig verkürzt auf eine rein instrumentelle Sicht, auf ausschließlich polizeiliche Maßnahmen. Die sozialen Umstände und Hintergründe einer solchen Tat und die psychischen Dispositionen von Tätern bleiben ausgeblendet. Entsprechende Forderungen werden gar als „naiv“ diskreditiert und Geflüchtete insgesamt – vor allem vor dem Hintergrund der Täter mit muslimischem Hintergrund in Ansbach und Würzburg – unter Generalverdacht gestellt. Das war selbst dem ehemaligen Bundesinnenminister Gerhard Baum (FDP) zu viel. Er wandte sich in einer ZDF Talkrunde vehement gegen diese Diskriminierung u.a. mit dem Satz „Politik auf dem Rücken der Opfer – das geht gar nicht!“
Mittlerweile schälen sich immer mehr Fakten zu den sozialen und psychischen Umständen der verschiedenen Täter heraus: so war der Selbstmordattentäter von Ansbach schon lange vorher „auffällig“ geworden, wie behandelnde Ärzte und Therapeuten bestätigen; er hatte in Syrien (wahrscheinlich) Frau und Kind verloren, war in bulgarischer Haft geschlagen und erniedrigt worden, hatte in seiner Einsamkeit immerhin zwei Suizidversuche unternommen. Und der „IS“ – wer immer sich hinter dem Chat-Partner, den man auf seinem Handy fand, verbergen mag – war nah dran an diesem Menschen und schickte ihn in den Tod. Für eine hochprofessionelle Terrororganisation wie den IS wirkten diese auffälligen Spuren allerdings höchst merkwürdig, ebenso wie die stümperhaft gebastelte Rucksackbombe. Die Frage aber bleibt: wo waren unsere „Einrichtungen“, wieso war kein Therapeut sein Chat-Partner, wieso wusste keiner vom anderen?
Der Amokläufer vom OEZ wurde in der Schule nicht nur gemobbt, sondern systematisch ausgegrenzt, geschlagen und gedemütigt, mit verheerenden Folgen für seinen Gemütszustand und sein Selbstbewusstsein. Aus dieser Situation rettete er sich über die Identifikation mit einem konfusen Arier-Verständnis, er bewunderte den Neo-Nazi und Massenmörder Anders Brevik. Seine Pseudoüberlegenheits-, Gewalt und Vernichtungsphantasien setzte er schließlich in die Tat um. Auch wussten eine Reihe von Betreuungseinrichtungen und Betreuern von den unterschiedlichen Auffälligkeiten, einschließlich seiner Aufenthalte in der Psychiatrie der Heckscher-Kliniken. Aber was wussten sie untereinander und voneinander?
Nun soll damit nicht das Wort geredet werden für den allumfassenden Datenaustausch und den gläsernen Patienten. Gerade bei den hier im Vordergrund stehenden Krankheitsbildern – wie Depression, narzisstische Persönlichkeitsstörung oder posttraumatische Belastungsstörung – kann es nur zu leicht zu einer Stigmatisierung und damit nochmaliger Ausgrenzung führen.
Dennoch bleiben Fragen, die gerade im Falle des Münchner Amokläufers gestellt werden sollten:
Wie wird in München zwischen Lehrer*innen, Schulsozialarbeit und Schulpsycholog*innen eine psychische Auffälligkeit kommuniziert?
Wie kann die Zusammenarbeit zwischen den schulischen Betreuungsdiensten, der Familien- und der Jugendhilfe und schließlich der Bezirkssozialarbeit so verbessert werden, dass zwischen „normaler“ Auffälligkeit und krankhafter Symptomatik wie einer „narzisstischen Störung“ – die Fachwelt spricht hier davon, dass der Betroffene u.a. „auf exzessive Bewunderung“ aus sei und unter „grandiosem Verständnis der eigenen Wichtigkeit“ leide – unterschieden werden?
Wie kann im Rahmen unserer kommunalen Gesundheitsprävention verhindert werden, dass eine gravierende narzisstische Störung mit ihren Neben- und Folgewirkungen nicht ausreichend diagnostiziert und behandelt wird?
Welche Maßnahmen könnten ergriffen werden, um frühzeitig zu erkennen, wenn Schüler und andere Jugendliche sich zurückziehen, Kontakte aufgeben und über pubertäre Attitüden hinausgehende Auffälligkeiten zeigen, die Anlass zur Sorge geben?
Solche Betreuungsnetze behutsam enger zu knüpfen, wäre allemal wichtiger, als nun die innere Militarisierung unserer Gesellschaft voranzutreiben, als Bundeswehreinsätze und ihre Zusammenarbeit mit der Polizei zu üben! Ein Bundeswehreinsatz im Inneren muss – mit den im Grundgesetz definierten Ausnahmen in Katastrophenfällen – ein Tabu bleiben: das Soldatengesetz zeigt auch sehr klar warum: der Soldat handelt immer nach den Grundätzen von „Befehl und Gehorsam“, dafür ist er als „Kombattant“ von aller Schuld und Verantwortung für seine befehlsgemäßen Taten „befreit“. Ein Polizeibeamter hingegen – und das unterscheidet uns immer noch wohltuend von Diktaturen und autoritären Regimes mit ihren Milizen, Sondertruppen und Spezialeinheiten – ist für sein Verhalten immer verantwortlich. „Befehl und Gehorsam“ mit der „Eigenverantwortlichkeit“ des Polizeibeamten zu vermischen, wäre ein weiterer übler Schritt in Richtung Aushöhlung unserer doch immerhin noch parlamentarischen Demokratie.
13.8.16, Jürgen Lohmüller