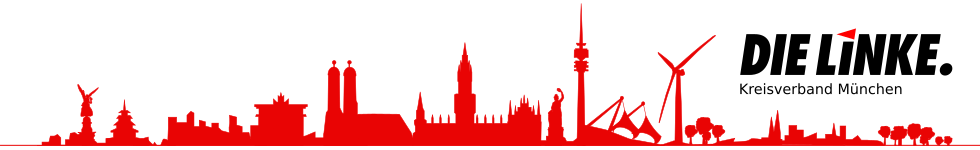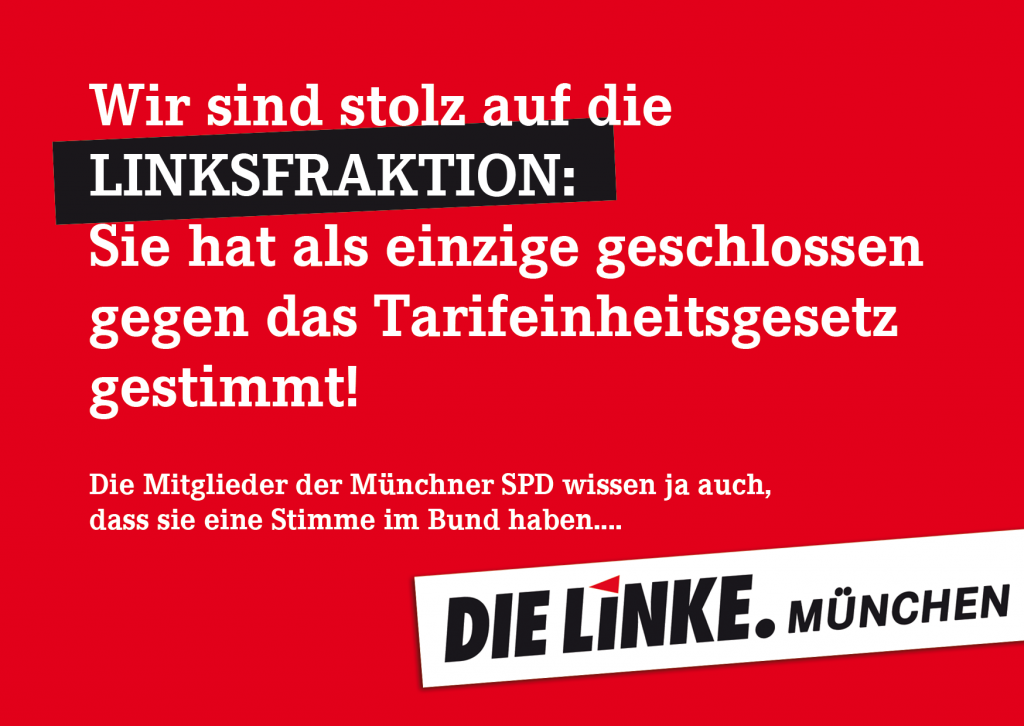Ein Kommentar zum Tarifeinheitsgesetz
von Florian Pollok, DIE LINKE. München
Nun haben sie es getan. Das Tarifeinheitsgesetz ist beschlossen. Union und SPD stimmten im Bundestag am 22. Mai überwiegend dafür. Einige Grüne enthielten sich, um nicht dagegen stimmen zu müssen, immerhin. Einzig die LINKSFRAKTION hat geschlossen gegen das Gesetzesansinnen und somit gegen die Einschränkung der Koalitionsfreiheit gestimmt. Das können wir LINKE. auch selbstbewusst nach außen tragen. Denn schließlich erzählt die Basis hier vor Ort nicht das Gegenteil von dem, was die Parlamentarier/-innen in Berlin treiben. Im Gegensatz zur politischen Konkurrenz. Wir sprechen mit einer Stimme. Im Bund und in der Kommune.
Während also bei den Christlichen immerhin 16 Nein-Stimmen ins Stimmergebnis fallen, hat bei der SPD lediglich eine einzige Abgeordnete gegen den Eingriff ins Grundrecht gestimmt – eine Aktivistin der „DBB-Spartengewerkschaft“ DPolG. Hier war ihr das Hemd wohl näher als die Hose. Alle anderen „Hellroten“ haben gezeigt, dass die SPD immer mehr zu einem FDP-Ersatz verkommt. Denn das neue Gesetz ist gleichbedeutend mit einer Einschränkung des Streikrechts. Und das kann nur im Interesse der Arbeitgeber sein. Oder im Interesse von Gewerkschaften, die sich im Buhlen um Mitglieder hiervon einen strukturellen Vorteil versprechen, zum Nachteil anderer. Auch wenn das nicht dem Geist der gewerkschaftlich so viel beschrieenen Solidarität entspricht, so haben gerade die großen Industriegewerkschaften des DGB und der Dachverband selbst hier eine unrühmliche Rolle inne. Denn die Genossen/-innen der SPD verstecken sich und ihren neoliberalen Kurs hinter der Argumentation, dass ihr Handeln dem Wunsch DER Gewerkschaften entspräche. Quatsch. Denn auch im DGB sind mehrere Gewerkschaften gegen die gesetzlich vorgeschriebene Tarifeinheit. So zum Beispiel die Dienstleistungsgewerkschaften GEW, NGG und ver.di. Und dann sind da auch noch die Spartengewerkschaften der DBB-Tarifunion…
Stein des Anstoßes
Aber nun soll es im Juli starten – das neue Gesetz. Wenn da nicht die Kleinigkeit wäre, dass es dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wahrscheinlich nicht standhält. Mehrere Spartengewerkschaften und ver.di haben bereits angekündigt, gegen das Gesetz zu klagen. Denn im neu beschlossenen Gesetz ist in der Begründung geregelt: „Wenn in einem Betrieb der Tarifvertrag einer Mehrheitsgewerkschaft gilt und eine Minderheitsgewerkschaft dennoch zum Streik aufruft, ist dieser nicht rechtmäßig, weil unverhältnismäßig.“ Die Unverhältnismäßigkeit des Streiks wird in der Begründung also von der Politik definiert, was dem Grundgesetz entgegensteht. Denn das stellt die Tarifautonomie in den Vordergrund. Und somit wird nach Auffassung der klagenden Gegner/-innen das neue Gesetz in Karlsruhe keinen Bestand haben. Wir werden sehen. Arbeitskämpfe sind zwar durch ständige Rechtsprechung bereits heute stark reglementiert und damit für Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite bereits gewisse Spielregeln klar definiert, jedoch gab es noch nie einen so gravierenden und tiefgehenden Eingriff. Die Antwort hierauf kann nur das Kassieren von Seiten der Verfassungshüter/-innen sein.
Trumpf des Arbeitgebers
Was bei dem Gesetz von den befürwortenden Gewerkschaften übersehen wird, ist die Tatsache, dass das Einbremsen anderer für das eigene Klientel gleichbedeutend mit der Begünstigung der Lohnspirale nach unten ist. Denn der (Verhandlungs-)Druck auf die Arbeitgeberseite sinkt mit jeder Einschränkung des Streikrechts. Zudem kann auch eine größere Gewerkschaft im Betrieb – hiervon ist nämlich im Gesetz die Rede – schnell zur kleineren werden und hat somit selbst das dem anderen zugedachte Nachsehen. Mehrere kleinere könnten sich strategisch auch zu einer Großen in bestimmten Betrieben verbinden, wie beispielsweise am Münchner Flughafen. Letztlich würden sich die Gewerkschaften damit noch mehr als bisher bekriegen. Das wiederum dürfte einzig die Arbeitgeber freuen. Denn wer tritt schon gerne sich (mit dem falschen) streitenden Organisationen bei? Und welche ist für den Außenstehenden dann eigentlich die richtige? Und hat der Arbeitgeber nicht Recht, wenn die sich schon untereinander nicht einig werden? In Zeiten, in denen sich Menschen immer weniger institutionell binden wollen, weil viele Individualismus mit Egoismus verwechseln und diesen hoch bewerten, sind solche Situationen für die Mitgliedergewinnung, und somit für die Durchsetzungsfähigkeit im Betrieb, denkbar ungünstig. Das ist bereits vor dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes so. Mit Inkrafttreten kommt dann noch die Komponente dazu, dass der Arbeitgeber nun gezielter eine Gewerkschaft gegen die andere ausspielen kann. Er hat ein neues Instrument bekommen. Mit dem wird es einfacher, den Preis für die Ware Arbeit niedrig zu halten. Es wird hier von DGB, IG Metall und Co. schlicht vergessen, wo der Interessengegensatz eigentlich stattfindet – zwischen Kapital und Arbeit. Zum Leidwesen aller auf der Arbeitseite.
Solidarprinzip vs. Sparten
Doch wie ist das nun eigentlich tatsächlich? Was ist besser? Sparte oder Großverbund? Was ist eigentlich der Unterschied? In linken Kreisen gelten die acht DGB-Gewerkschaften vielen als wenig fortschrittlich und streikunfähig. Was mitunter an den moderaten Tarifabschlüssen und den – im europäischen Vergleich – wenigen Streiktagen liegt. Sieht man hingegen die Arbeitskämpfe von Marburger Bund (Ärzte/-innen), Vereinigung Cockpit (Piloten/-innen), sowie GdL (Lokomotivführer/-innen), so teilen gerade Linke oft die Auffassung, dass dies der Weg sei, dem die Großen des DGB folgen sollten. So in etwa höre auch ich das immer wieder in zahlreichen Diskussionen zum Thema. Doch so einfach ist das für mich nicht, wenngleich ich mir manchmal wünsche, dass es im Sinne der Erwerbsarbeit Abhängigen besser laufen würde. Aber wie heißt es so schön. Wir sind hier nicht bei wünsch dir was, sondern bei so ist es. Doch was ist eigentlich so?
Zu allererst sind da die äußeren Rahmenbedingungen, die Marktwirtschaft, der Kapitalismus. Die Arbeitgeber verstehen es gerade in der BRD sehr gut, sich durch ihre Lobbykonstellationen in allen Bereichen der Gesellschaft Vorteile zu verschaffen. Nicht umsonst klafft die Schere zwischen arm und reich immer deutlicher auseinander. Das hängt auch damit zusammen, dass sie es schaffen, dass immer weniger Menschen bereit sind sich zu organisieren. Durch gezielte Medien-Kampagnen, die den Menschen suggerieren, dass sie sich von den Gewerkschaften fern halten sollen, weil die schädlich seien. Die Wirtschaft würde sonst leiden, und, und, und. Viele glauben durch die Gehirnwäsche hierzulande auch, dass es ein Privileg sei, überhaupt Arbeit zu haben, auch wenn diese prekär und grottigst bezahlt ist. Sie sehen nicht, dass durch die Arbeit der Gesellschaft insgesamt genügend rein kommt, so dass alle ohne Probleme ein Einkommen zum Auskommen haben könnten. Als Gewerkschafter/-in hat man hier bereits die erste Herausforderung, die Menschen vom Gegenteil zu überzeugen. Aber dann haben sie noch lange nicht gestreikt. Zudem muss man sich auch immer branchenspezifisch anschauen: Was geht, was geht nicht. Bei manchen Berufsfeldern ist der Selbstausbeutungstrieb immens hoch. Und dann ist da noch der bereits vorhandene rechtlich gesteckte Rahmen für Arbeitskämpfe, den es zu beachten gilt. Arbeitskämpfe sind nämlich immer nur die Ultima Ratio. Sprich, das letzte Mittel, um Forderungen durchzusetzen. Hinzu kommt, dass selbst für diese Ultima Ratio auch noch Stufen zu beachten sind. So müssen einem Erzwingungsstreik entsprechende Warnstreiks vorausgegangen sein. Diese wiederum müssen bereits verhältnismäßig aufeinander aufgebaut gewesen sein. Hier gilt es bereits im Vorfeld zu schulen, zu „impfen“ und mitzunehmen. Während der Friedenspflicht gilt es da bereits Vorbereitungen zu treffen – vor dem Streik ist nach dem Streik. Notfallpläne müssen gegebenenfalls errichtet und Auswirkungen auf andere Bereiche abgeschätzt und beurteilt werden. Das sind alles Dinge, die eine/-n normal Beschäftigte/-n im Grunde erst mal nicht tangieren. Der/die sollte aber im Kern darüber Bescheid wissen, sonst fehlt oftmals die Motivation zur Beteiligung am Arbeitskampf. Oder die Angst vor Arbeitgeber-Repressionen überwiegt. Der Kampf um die Köpfe hat hier längst im Betrieb Einzug gefunden. Lange bevor überhaupt irgendwas in Richtung Streik passieren kann. So stellt sich das für die Gewerkschaften in der Realität dar. Wobei hier nur einige Widrigkeiten beispielhaft aufgezählt sind. Die Romantik, man müsse doch nur einmal mit der Fahne wedeln und alle würden folgen, ist – um es einfach auszudrücken – Mist! Denn nun stellt sich für alle die Frage, in welche Gewerkschaft gehe ich denn? Spartengewerkschaft oder Einheitsgewerkschaft? Und beteilige ich mich dann überhaupt?
Ich habe da als DGB-Mitgliedsgewerkschaftszugehöriger natürlich eine Präferenz. Die würde ich so beschreiben: Wenn es um die Ausbeutung von Arbeiter/-innen weltweit geht, so gilt der Spruch „Eure Armut ist unser Reichtum“. Nur weil andere günstig produzieren oder Dienst leisten, ist der Standard hierzulande so hoch. Ähnlich kann man das auch beim Verhalten der Spartengewerkschaften im Betrieb sehen. Auch wenn der Vergleich nicht ganz dasselbe ist, aber die Richtung für mich stimmt. Denn die Spartengewerkschaften holen oft nur für sich sehr viel raus, was sich auf den Verteilungsspielraum des vorhandenen Geldes im Betrieb auswirkt. Es kann schließlich nur ausgegeben werden, was auch da ist. Und irgendwer bleibt somit auf der Strecke. Holen die Ärzte der Spartengewerkschaft Marburger Bund in Krankenhäusern beispielsweise für sich alleine im Proporz sehr viel mehr raus, dann bleibt entsprechend weniger vom Kuchen für die Krankenpfleger/-innen, Hebammen, Pflegeassistenzen, Verwaltungsmitarbeiter/-innen, Köche/-innen, das Reinigungspersonal und die vielen anderen im Betrieb vertretenen Berufe. ver.di hingegen, ebenso im Krankenhausbereich zuständig, hat den Anspruch, für alle Berufe in einem Betrieb gleichermaßen die Preise zu erhöhen, was wiederum einen moderateren Abschluss nach sich zieht. Allerdings zu Gunsten aller im Betrieb Beschäftigten Arbeitnehmer/-innen, nicht nur für einen (Berufs)Teil. Und haben mehr Menschen mehr Geld in der Tasche, dann steigt die Binnennachfrage, Arbeitsplätze entstehen. Wenn sich das Geld auf nur wenige verteilt, geben diese nicht unbedingt mehr aus, sondern sparen, bzw. häufen Geld an. Diesem Prinzip „Ein Betrieb – eine Gewerkschaft“ haben sich im Kern die DGB-Gewerkschaften verpflichtet, so dass es eben nicht zur Lohnkonkurrenz der Beschäftigten untereinander kommen kann. So die Theorie. Ich für meinen Teil befürworte das, denn das sorgt auch für den sozialen Frieden im Betrieb und letztlich in der Gesellschaft. Die DGB-Gewerkschaften tun also gut daran, wenn sie im Kampf um die Mitglieder diese Prinzipien nicht vergessen.
Fazit
Abhängig Beschäftigte sitzen letztlich alle in einem Boot. Wir tun gut daran, dass wir untereinander Zuständigkeiten oder Symbiosen bzw. Doppelzuständigkeiten regeln. Dann gibt man auch niemandem Anlass, zu regulieren. Ein Einschreiten des Gesetzgebers ist in jedem Fall immer ein Nachteil zu Gunsten der Kapitalseite. Und ein Armutszeugnis für den Solidargedanken. Der hat eigentlich dazu geführt, dass Erwerbsarbeit-Abhängige überhaupt Tarifverträge haben. Und wir Linken (klein geschrieben) tun gut daran, wenn wir Unterstützung leisten, wo es notwendig ist und nicht nur immer auf die „Apparratschiks“ schimpfen, sondern vielleicht vorher auch mal fragen, wie siehts aus?